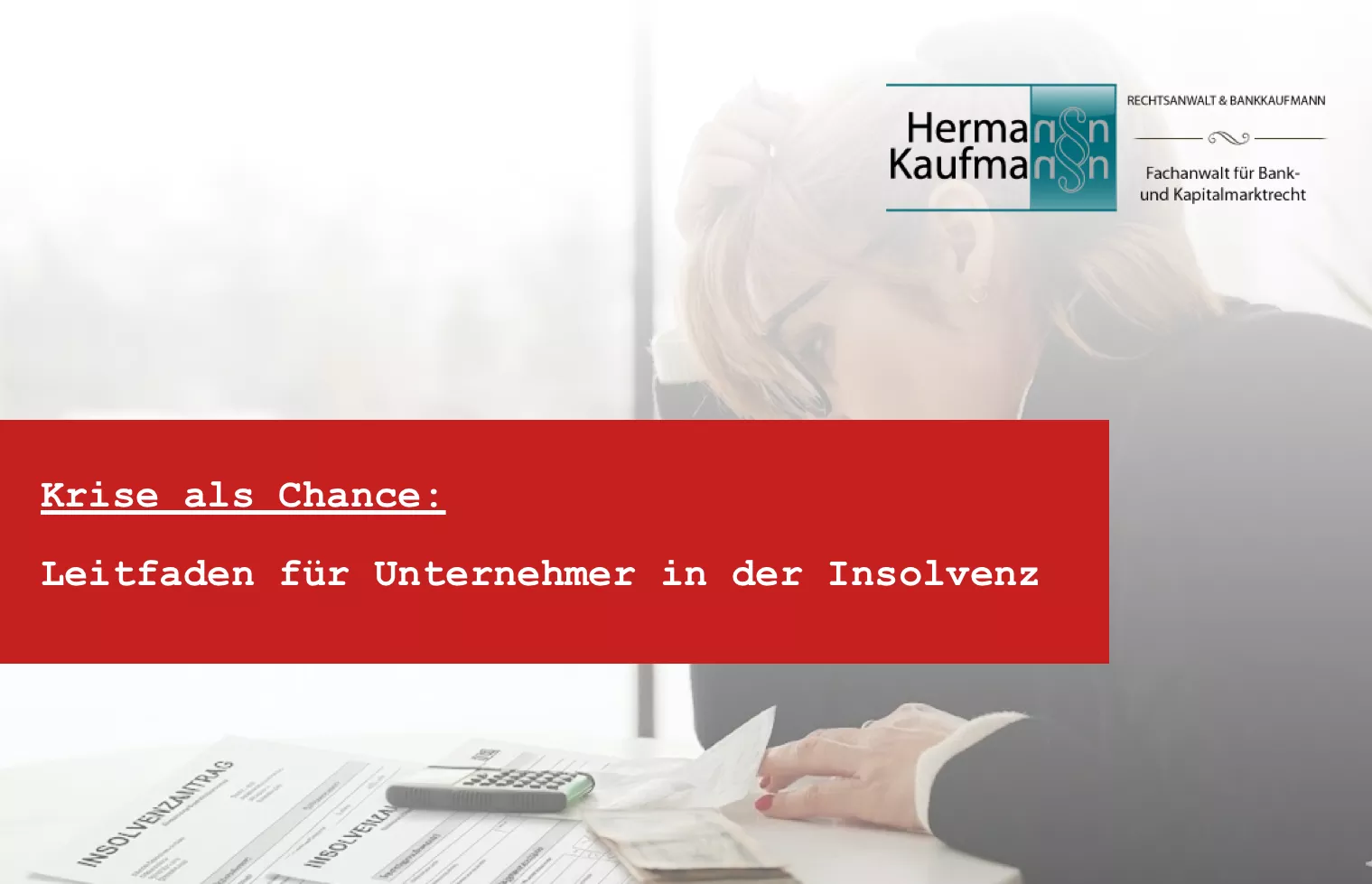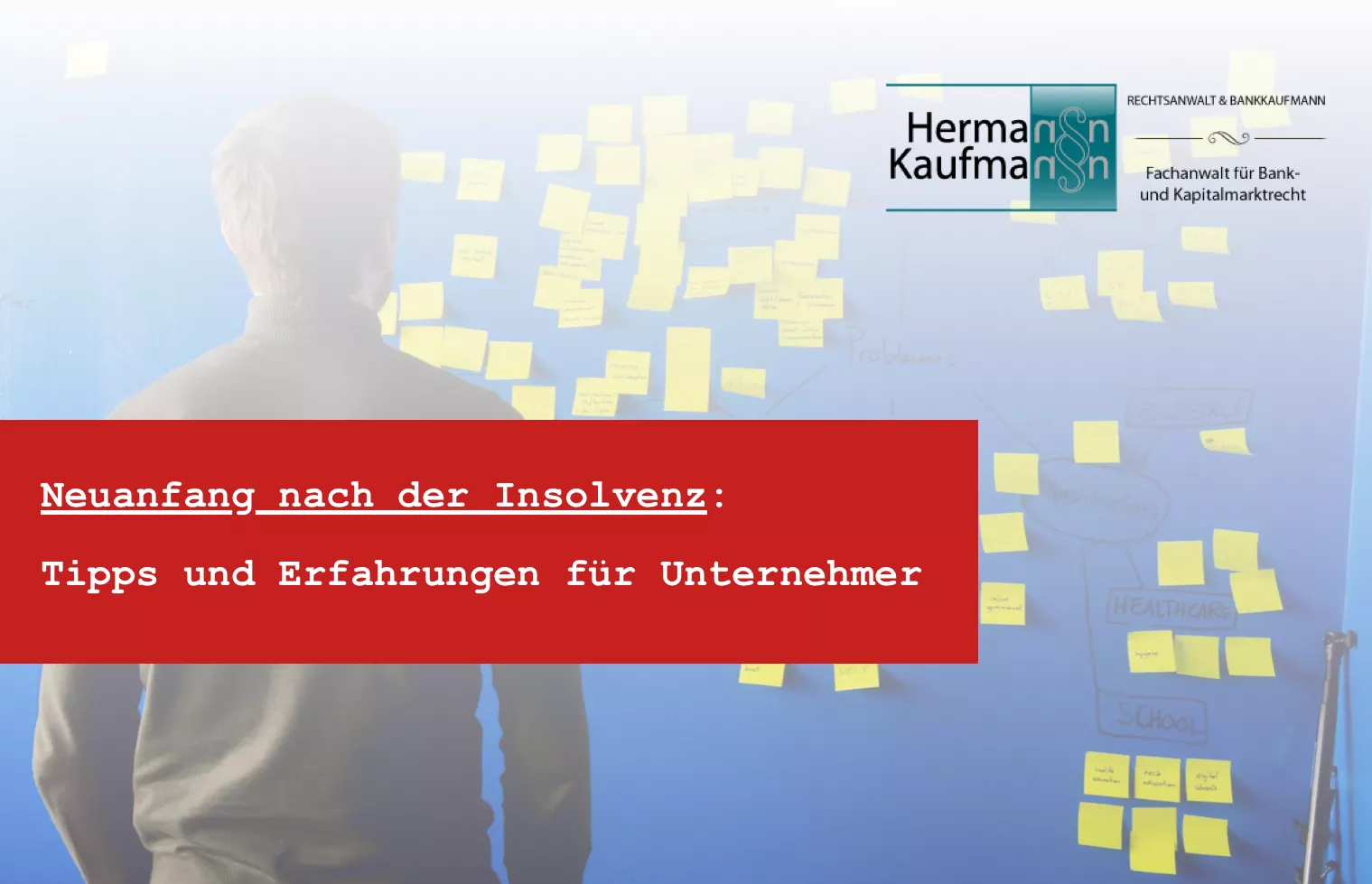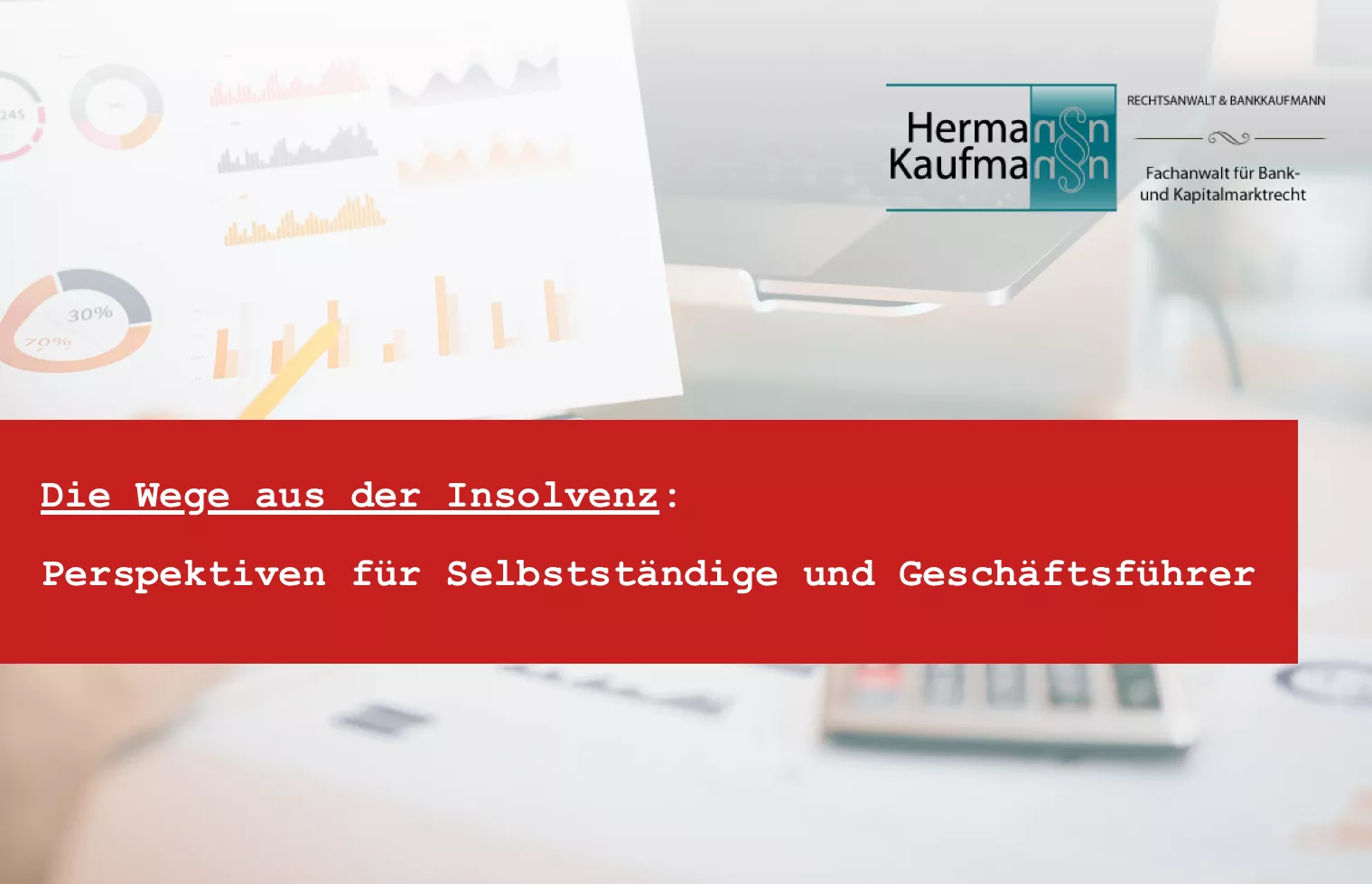Inhaltsverzeichnis
- 1 Vollstreckung deutscher Zivilurteile in England nach dem Brexit | 2025
- 1.1 Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen (HGÜ)
- 1.2 Lugano-Übereinkommen von 2007 (LugÜ)
- 1.3 Unser Weg: Das Deutsch-Britische Abkommen von 1960
- 1.4 Haben Sie Fragen zur Vollstreckung deutscher (Zivil-) Urteile in England?
- 1.5 Fragen und Antworten zum Thema Zwangsvollstreckung in England nach Brexit:
- 1.5.1 Warum ist die Vollstreckung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich nach dem Brexit komplizierter geworden?
- 1.5.2 Warum wurde das Lugano-Übereinkommen (LugÜ) nicht als Alternative zur EuGVVO eingeführt?
- 1.5.3 Welche rechtliche Grundlage wurde im Mandat der Kanzlei genutzt, um das deutsche Urteil in England zu vollstrecken?
- 2 Mehr zum Thema Brexit-Urteilsvollstreckung:
- 3 Quellen – Brexit-Urteilsvollstreckung:
Vollstreckung deutscher Zivilurteile in England nach dem Brexit | 2025
Viele Möglichkeiten, viel Bürokratie und wenig Rechtssicherheit bei einer Vollstreckung im Vereinigten Königreich nach dem Brexit
Der Brexit hat die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anerkennung und Vollstreckung deutscher Gerichtsurteile im Vereinigten Königreich (UK) erheblich verändert. Bis zum 31. Dezember 2020 galt die Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO), die eine automatische Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen zwischen EU-Mitgliedstaaten ermöglichte. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und dem Ende der Übergangsphase findet die EuGVVO jedoch keine Anwendung mehr auf Verfahren, die nach diesem Datum eingeleitet wurden.
In der Folge sind Unternehmen und Privatpersonen mit Unsicherheiten konfrontiert, da die bisherigen EU-weiten Regelungen entfallen sind.
Dieser Artikel befasst sich mit den Möglichkeiten, deutsche Urteile in dem Vereinigten Königreich (hauptsächlich England) zu vollstrecken und gibt einen Einblick in unsere Herangehensweise anhand eines unserer Mandate.
Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen (HGÜ)
Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen (HGÜ) von 2005 regelt die internationale Zuständigkeit von Gerichten in Zivil- und Handelssachen und verpflichtet die Vertragsstaaten, Urteile von Gerichten, die auf einer ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarung beruhen, anzuerkennen und zu vollstrecken. Damit stellt das Übereinkommen eine wesentliche Grundlage für die Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen dar, wenn zwischen den Parteien eine exklusive Gerichtsstandsvereinbarung getroffen wurde.
Das Vereinigte Königreich ist zum 1. Januar 2021 formell dem HGÜ beigetreten. Bis zum Brexit war es bereits als EU-Mitglied an das Übereinkommen gebunden. Die rechtliche Situation hat sich dadurch insofern verändert, als nun die Anwendbarkeit des HGÜ auf Gerichtsstandsvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2021 geschlossen wurden, fraglich ist. Das Vereinigte Königreich vertritt die Auffassung, dass es seit dem 1. Oktober 2015 ohne Unterbrechung Vertragsstaat des Übereinkommens sei, was jedoch von anderen Staaten, insbesondere der EU, nicht uneingeschränkt anerkannt wird. Dadurch entsteht Rechtsunsicherheit für Fälle, in denen eine exklusive Gerichtsstandsvereinbarung zwischen 2015 und 2020 getroffen wurde.
Das HGÜ bietet im Grundsatz eine klarere Rechtslage als die rein nationalen Regelungen, da es eine einheitliche Grundlage für die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen schafft. Dennoch ist der Anwendungsbereich des Übereinkommens beschränkt. Es gilt ausschließlich für Zivil- und Handelssachen, sofern eine ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung zwischen den Parteien existiert. Davon ausgenommen sind unter anderem Verbraucherangelegenheiten, familienrechtliche Streitigkeiten, Miet- und Pachtverhältnisse sowie bestimmte außervertragliche Schadensersatzansprüche.Zudem gibt es im Vergleich zur früheren Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO) einige Unklarheiten. Ein Beispiel hierfür ist die Frage, ob ein Verfahren nach Art. 31 Abs. 2 EuGVVO ausgesetzt werden kann, wenn eine Klage unter Berufung auf eine Gerichtsstandsvereinbarung bereits bei einem anderen Gericht anhängig ist. Zwar sieht das HGÜ ebenfalls eine Regelung zur Verhinderung paralleler Verfahren vor, jedoch ist der Prüfungsmaßstab umfassender und komplexer, sodass sich Verzögerungen und Rechtsunsicherheiten ergeben können.
Lugano-Übereinkommen von 2007 (LugÜ)
Das Lugano-Übereinkommen von 2007 (LugÜ) wurde ursprünglich geschaffen, um die europäischen Verfahrensregeln auf die Staaten der Europäischen Freihandelszone (EFTA) auszuweiten. Inhaltlich lehnt es sich stark an die frühere EuGVÜ und damit auch an die Brüssel-I-Verordnung (EuGVVO) an. Das Übereinkommen regelt die gerichtliche Zuständigkeit sowie die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen zwischen den Vertragsstaaten, zu denen neben den EU-Mitgliedstaaten auch Island, Norwegen und die Schweiz gehören.
Nach dem Brexit hätte das LugÜ eine Möglichkeit geboten, die Vollstreckung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich zu erleichtern und an die zuvor geltenden Regelungen der EuGVVO anzuknüpfen. Das Vereinigte Königreich stellte daher am 8. April 2020 einen Antrag auf Beitritt zum Übereinkommen. Für einen Beitritt wäre jedoch die Zustimmung aller Vertragsparteien, also der EFTA-Staaten sowie der EU, erforderlich gewesen. Während die Schweiz, Norwegen und Island dem Antrag wohlwollend gegenüberstanden, äußerte sich die Europäische Kommission zurückhaltend und lehnte den Beitritt letztlich ab.
Die Ablehnung der EU könnte strategische Gründe gehabt haben, insbesondere im Kontext der schwierigen Brexit-Verhandlungen. Allerdings gibt es auch inhaltliche Bedenken. So bleibt das Lugano-Übereinkommen hinter dem aktuellen Stand der EuGVVO zurück und könnte problematische rechtliche Entwicklungen begünstigen, etwa forum shopping, Anti-Suit Injunctions oder Torpedoklagen. Zudem verpflichtet das LugÜ die Mitgliedstaaten lediglich dazu, die Rechtsprechung der europäischen Gerichte zu „berücksichtigen“, nicht aber zwingend anzuwenden. Dadurch könnten englische Gerichte wieder eigene Verfügungen gegen europäische Verfahren erlassen, was der EU ein Dorn im Auge ist.Da das Vereinigte Königreich nicht Mitglied der EFTA ist und sich ein politischer Konsens über seinen Beitritt zum LugÜ nicht abzeichnet, ist ein zukünftiger Beitritt äußerst unwahrscheinlich. Die Frist zur Zustimmung nach Art. 72 Abs. 3 LugÜ ist abgelaufen, ohne dass eine Einigung erzielt wurde. Damit steht fest, dass das LugÜ im Verhältnis zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich nicht anwendbar ist.
Rechtsanwalt Hermann Kaufmann steht für eine umfassende Beratung zum Thema Zwangsvollstreckung in England nach Brexit zur Verfügung.
Unser Weg: Das Deutsch-Britische Abkommen von 1960
Das Deutsch-Britische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen aus dem Jahr 1960 ist eine der wenigen bestehenden Rechtsgrundlagen für die grenzüberschreitende Vollstreckung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich nach dem Brexit.
In einem aktuellen Mandat unserer Kanzlei betreuen wir eine Gläubigerin, die 2022 vor dem Landgericht Verden geklagt hat und 2023 ein rechtskräftiges Urteil erwirkte, mit dem die Schuldnerin – ein Unternehmen mit Sitz in London – zur Zahlung von ca. 10.000 € verurteilt wurde. Um die Forderung in Großbritannien durchzusetzen, haben wir Kontakt zur Foreign Process Section des Royal Court of Justice aufgenommen. Dort wurde uns bestätigt, dass die Vollstreckung nach britischem Recht über PART 74 CPR – Enforcement of Judgments in Different Jurisdictions in Verbindung mit dem Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 erfolgen kann.
Das Verfahren basiert auf dem Deutsch-Britischen Abkommen von 1960, das weiterhin als Grundlage für die Vollstreckung deutscher Urteile dient. Die britischen Behörden stützen sich hierbei auf den Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, der eine vereinfachte Anerkennung ausländischer Urteile ermöglicht, sofern ein bilaterales Abkommen zwischen den Staaten besteht.
Zur Vollstreckung des deutschen Urteils muss ein Antrag bei der King’s Bench Division des High Court gestellt werden. Die erforderlichen Unterlagen umfassen:
- Application Notice (Formular N244)
- Draft Order (Formular PF 160)
- Originales deutsches Urteil und beglaubigte englische Übersetzung
- Ein weiteres Duplikat aller vorgenannten Unterlagen
- Drei Kopien der Draft Order (PF 160)
Die Gerichtsgebühr beträgt 78 Pfund.
Dieses Verfahren ermöglicht es, das deutsche Urteil in ein britisches Urteil umzuwandeln, das anschließend nach den britischen Vollstreckungsvorschriften durchgesetzt werden kann. Während das Abkommen nicht die automatische Anerkennung nach früheren EU-Regelungen bietet, stellt es dennoch die sicherste und praktikabelste Option dar, um rechtskräftige deutsche Urteile im Vereinigten Königreich durchzusetzen.
Disclaimer: Auch dieses Abkommen hat einen eingeschränkten Anwendungsbereich und ist daher nicht für jede Art von Urteilen ohne weiteres anwendbar!
Rechtsanwalt Hermann Kaufmann steht für eine umfassende Beratung zum Thema „Zwangsvollstreckung in England nach Brexit“ zur Verfügung: Nehmen Sie gerne Kontakt auf!
Haben Sie Fragen zur Vollstreckung deutscher (Zivil-) Urteile in England?
Falls Sie einen Schuldner in England und Probleme bei der Vollstreckung eines Urteils gegen diesen Schuldner haben, dann lassen Sie sich von einem Rechtsanwalt beraten. Unsere Kanzlei steht im Austausch mit den Gerichten in England und nimmt sich Ihrer Sache gerne an.
Hier können Sie uns kontaktieren:
📞 Tel.: 04202 / 638370
📧 E-Mail: info@rechtsanwaltkaufmann.de
Sie benötigen eine Beratung zum Thema Zwangsvollstreckung in England nach Brexit oder haben Sie einen Titel zur Vollstreckung in anderen Ländern?
Dann lassen Sie sich gerne von unseren spezialisierten Anwälten beraten.
Die enthaltenen Informationen in diesem Artikel dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Person. Sie stellen keine rechtliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen.
Eine individuelle Beratung mit einem Rechtsanwalt wird empfohlen, um Ihre spezifische Situation zu bewerten und eine maßgeschneiderte Vorgehensweise zu entwickeln.
Fragen und Antworten zum Thema Zwangsvollstreckung in England nach Brexit:
-
Warum ist die Vollstreckung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich nach dem Brexit komplizierter geworden?
Nach dem Brexit findet die Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO) keine Anwendung mehr auf Verfahren, die nach dem 31. Dezember 2020 eingeleitet wurden. Dadurch entfällt die automatische Anerkennung und Vollstreckung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich, die zuvor durch das EU-Regelwerk gewährleistet war. Gläubiger müssen sich nun auf alternative Rechtsgrundlagen stützen, wie das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen (HGÜ) oder das Deutsch-Britische Abkommen von 1960, wobei diese Abkommen gewisse Einschränkungen und Unsicherheiten mit sich bringen.
-
Warum wurde das Lugano-Übereinkommen (LugÜ) nicht als Alternative zur EuGVVO eingeführt?
Das Vereinigte Königreich hatte am 8. April 2020 einen Antrag auf Beitritt zum Lugano-Übereinkommen von 2007 gestellt. Dies hätte eine reibungslose Vollstreckung deutscher Urteile ermöglicht, da das LugÜ ähnliche Regelungen wie die EuGVVO enthält. Allerdings lehnte die Europäische Kommission den Beitritt des Vereinigten Königreichs ab. Gründe hierfür waren unter anderem:
– Strategische Überlegungen im Zuge der Brexit-Verhandlungen
– Inhaltliche Bedenken, da das LugÜ verfahrensrechtlich hinter der EuGVVO zurückbleibt
– Die Gefahr von Rechtsmissbrauch durch Forum Shopping, Anti-Suit Injunctions oder Torpedoklagen, da das Vereinigte Königreich zudem kein Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist, bleibt ein zukünftiger Beitritt äußerst unwahrscheinlich. -
Welche rechtliche Grundlage wurde im Mandat der Kanzlei genutzt, um das deutsche Urteil in England zu vollstrecken?
Die Kanzlei stützte sich auf das Deutsch-Britische Abkommen von 1960, das weiterhin als Rechtsgrundlage für die Anerkennung und Vollstreckung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich dient. Auf dieser Grundlage konnten die britischen Behörden den Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 anwenden, der eine Vollstreckbarerklärung durch den High Court (King’s Bench Division) ermöglicht.
Der Antrag musste gemäß PART 74 CPR – Enforcement of Judgments in Different Jurisdictions eingereicht werden und erforderte folgende Unterlagen:
– Application Notice (N244)
– Draft Order (PF 160)
– Originales deutsches Urteil & beglaubigte englische Übersetzung
– Ein Duplikat der vorgenannten Unterlagen
– Drei Kopien der Draft Order
– Die Gerichtsgebühr beträgt 78 Pfund.Dieses Verfahren ermöglicht es, das deutsche Urteil in ein britisches Urteil umzuwandeln und somit nach britischem Recht zu vollstrecken. Trotz des zusätzlichen Verwaltungsaufwands stellt es die sicherste und praktikabelste Option zur grenzüberschreitenden Durchsetzung deutscher Urteile im Vereinigten Königreich dar.
Mehr zum Thema Brexit-Urteilsvollstreckung:
Quellen – Brexit-Urteilsvollstreckung:
- https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/full-text/?cid=98
- https://www.gov.uk/government/publications/form-pf160-order-for-registration-for-enforcement-in-england-and-wales-of-a-foreign-judgment-under-the-administration-of-justice-act-1920-the-foreig
- https://www.gov.uk/government/publications/form-pf159b-evidence-in-support-of-application-for-registration-for-enforcement-in-england-and-wales-of-a-foreign-judgment-under-the-foreign-judgment
- https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/13
- https://www.gesetze-im-internet.de/vollstrabkgbrag/VollstrAbkGBRAG.pdf
- https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part74/pd_part74a#IDA2BUJC
- https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part74#74.3
- https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/international/aktuelles/anerkennung-von-urteilen-bei-brexit-4892634
- https://bccg.de/rechtssichere-vollstreckung-von-gerichtsurteilen-nach-dem-brexit/
- https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2021/ausgabe-10-2021-v-14052021/beitritt-des-uk-zum-luganer-uebereinkommen-kom/
- https://www.nzz.ch/meinung/alleingang-der-eu-kommission-zulasten-des-europaeischen-justizraums-ld.1640692
- https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-table/?cid=98