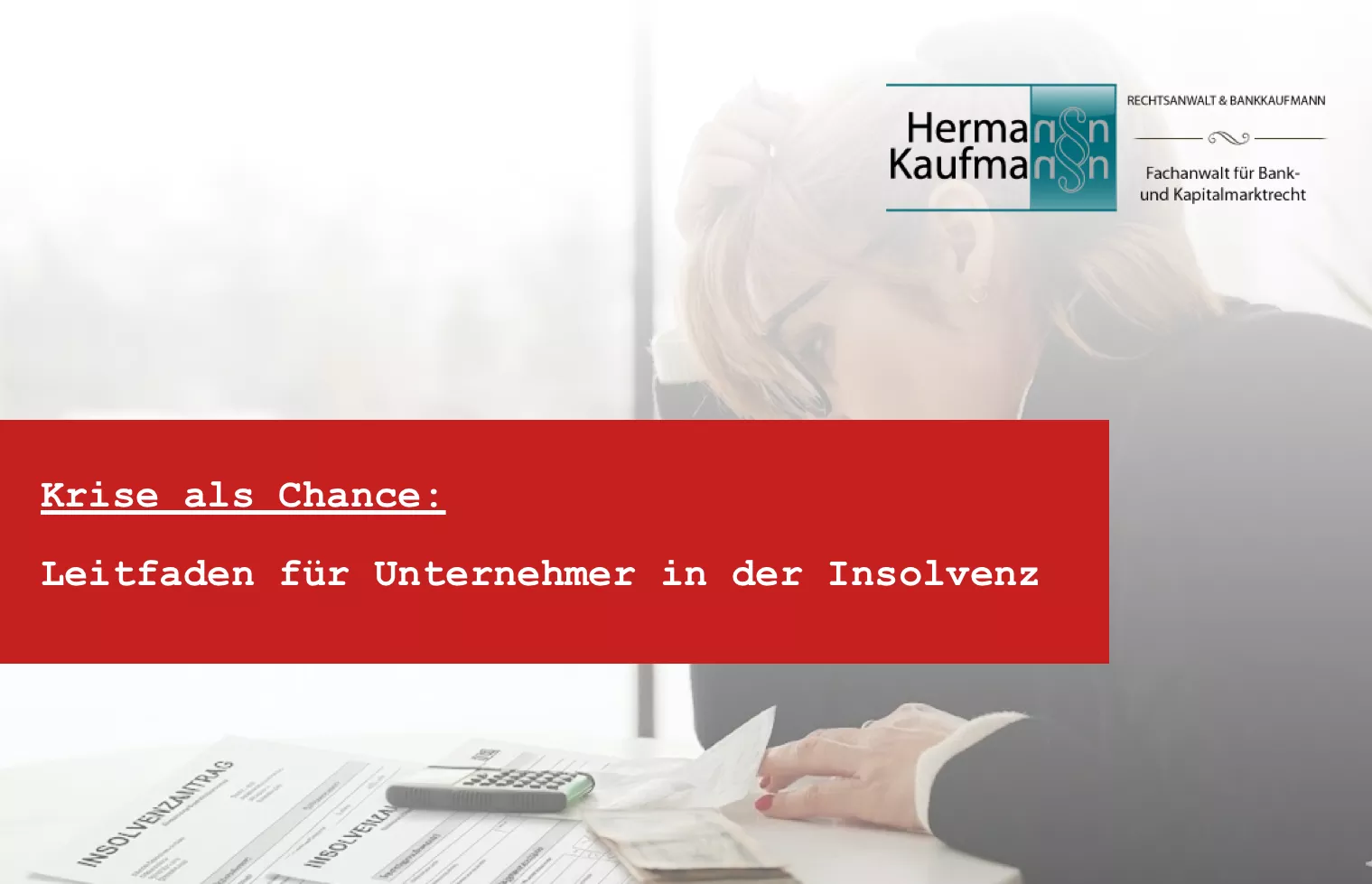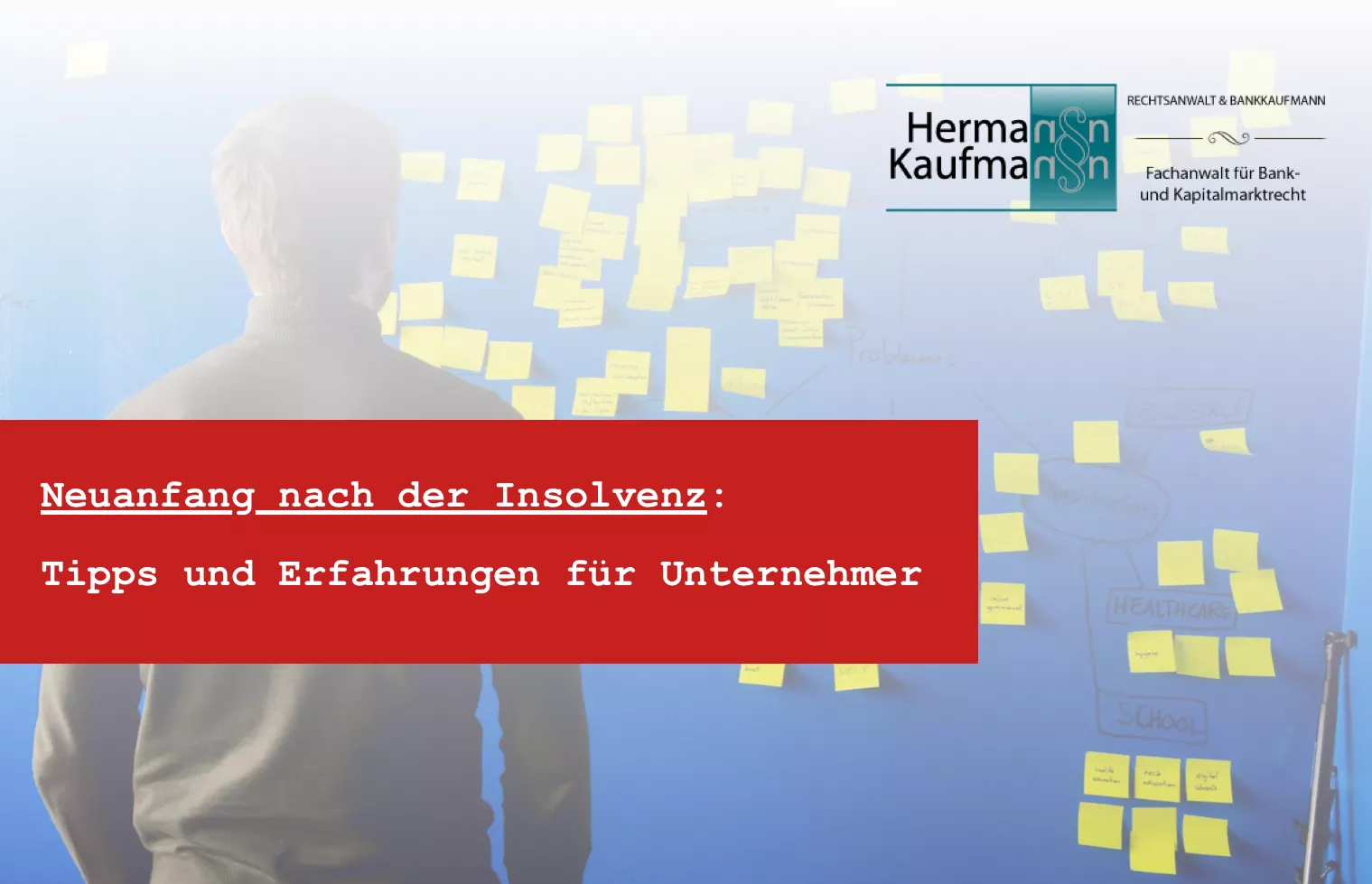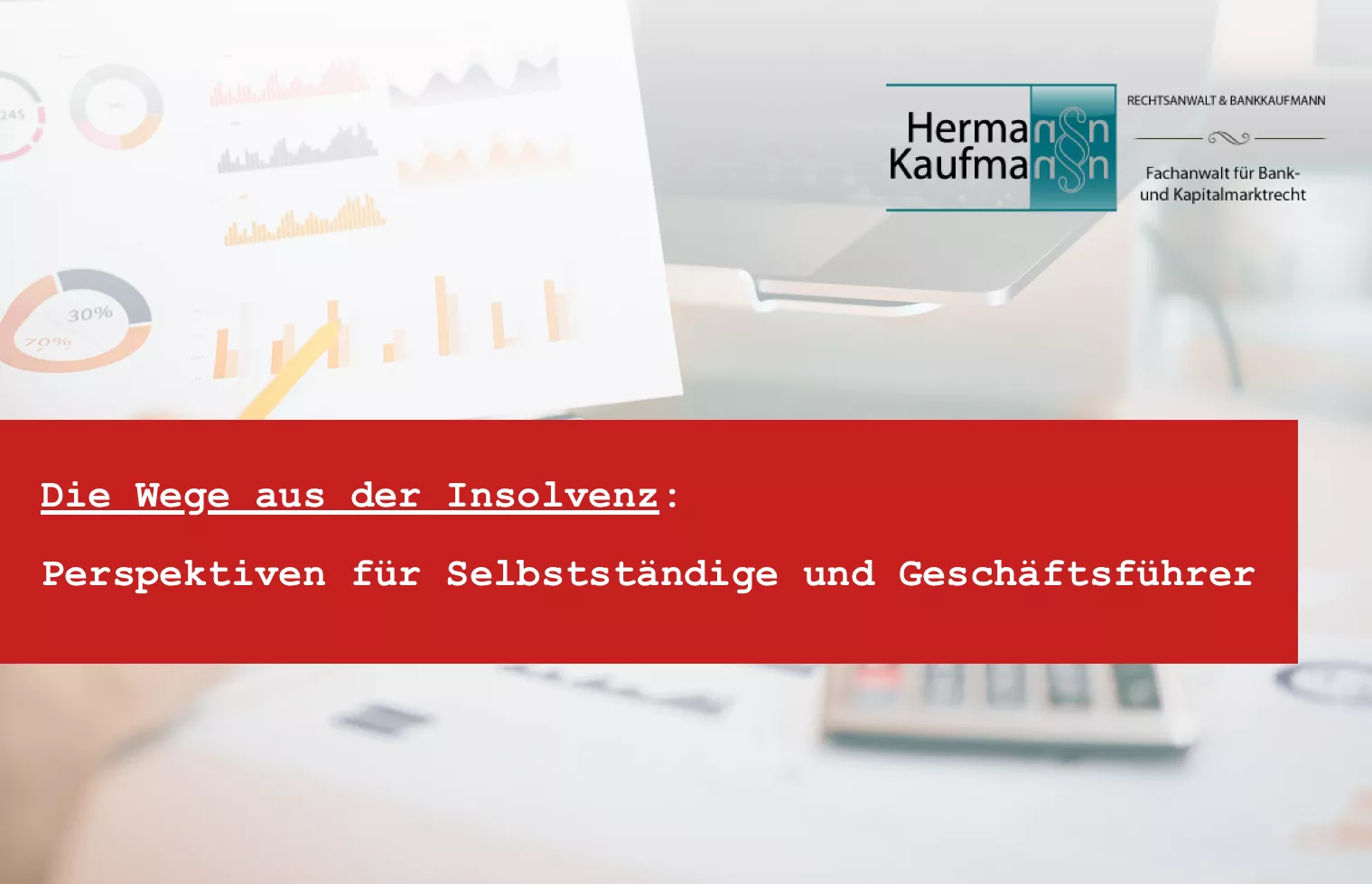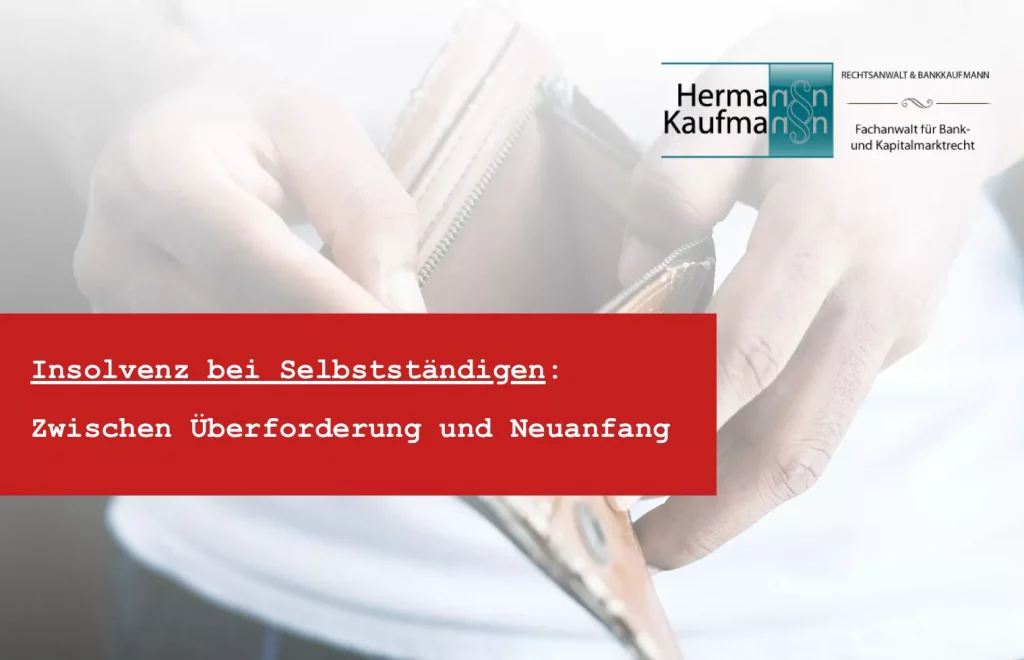
Inhaltsverzeichnis
- 1 Insolvenz bei Selbstständigen: Zwischen Überforderung und Neuanfang
- 2 Zusammenfassung zum Thema Insolvenz bei Selbstständigen:
- 3 Fazit: Insolvenz ist kein Ende – sondern oft ein realer Neuanfang
- 4 Mehr zum Thema Insolvenzrecht:
- 5 Quellen für Insolvenz Selbstständig:
Insolvenz bei Selbstständigen: Zwischen Überforderung und Neuanfang
Was Sie in der Krise wissen sollten – über Geld, Schuldgefühle, Entscheidungen und Wege aus der Überlastung
„As an entrepreneur, you only fail when you give up.“ ~ Naveen Jain.
Finanzielle Schwierigkeiten sind für viele Selbstständige nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine tiefe persönliche Krise. Wer sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, identifiziert sich oft stark mit der eigenen beruflichen Rolle. Gerät das Unternehmen ins Wanken, wankt häufig auch das Selbstwertgefühl. Gedanken wie „Ich habe versagt“ oder „Was werden andere denken?“ sind keine Seltenheit.
Psychologisch betrachtet ist das nachvollziehbar: Der Beruf ist für viele Menschen ein zentraler Bestandteil ihrer Identität. Kommt es zu einem Kontrollverlust – etwa durch unbezahlbare Rechnungen, schwindende Aufträge oder beharrliche Mahnungen – schlägt das nicht nur aufs Konto, sondern auch auf die Psyche. Studien zeigen, dass wirtschaftliche Überforderung häufig mit Scham, sozialem Rückzug und sogar depressiven Symptomen einhergeht. Genau deshalb ist es wichtig, über die Option einer Insolvenz offen zu sprechen – nicht als Kapitulation, sondern als möglichen Wendepunkt.
Zusammenfassung zum Thema Insolvenz bei Selbstständigen:
- Psychische Lage & Coping: Finanzielle Krise trifft Identität; Scham/Resignation führen oft zu „verzögertem Coping“. Früh über Optionen sprechen, Hilfe annehmen, Handlungsfähigkeit zurückgewinnen.
- Rechtliche Auslöser & Pflichten: Insolvenzgründe: Zahlungsunfähigkeit (§17 InsO), drohende Zahlungsunfähigkeit (§18), Überschuldung (§19). Für juristische Personen/§15a InsO: Antragspflicht binnen 3 Wochen; bei Einzelunternehmern frühzeitig handeln, sonst Risiko für Restschuldbefreiung (§§286, 290).
- Verfahrensweg (Selbstständige): i.d.R. Regelinsolvenz (§305); ehemals Selbstständige ggf. Verbraucherinsolvenz (§304). Schritte: Antrag → Eröffnungsprüfung/ggf. vorl. Verwalter (§§21–22) → Eröffnung/Verwalter (§27) → Verwertung/Verteilung (§§159 ff.) → Wohlverhaltensphase (§295; Abführung wie pfändbares Angestellten-Einkommen).
- Restschuldbefreiung & Ausnahmen: Regeldauer seit 17.12.2020: 3 Jahre (§300). Nicht umfasst: u.a. Geldstrafen und vorsätzliche unerlaubte Handlungen (§302).
- Praktische Empfehlung/Neustart: Insolvenz ist kein Scheitern, sondern strukturierter Neustart. Früh juristisch beraten lassen, realistische Planung statt Durchhalteparolen. Kontakt: Tel. 04202 / 6 38 37 0, info@rechtsanwaltkaufmann.de.
Insolvenz – ein Schritt mit viel innerem Widerstand
Dass viele Selbstständige viel zu spät über Insolvenz nachdenken, liegt nicht nur an Unwissen oder falscher Hoffnung. Es liegt auch daran, wie wir als Menschen mit Krisen umgehen:
Psychologen nennen das „verzögertes Coping“. Man hält an der alten Lösung fest, versucht zu retten, was zu retten ist – aus Loyalität, Verantwortung oder Angst vor Stigmatisierung. Das ist menschlich. Aber je länger man wartet, desto enger wird der Spielraum – und desto größer das Risiko rechtlicher und finanzieller Konsequenzen. Der erste Schritt ist daher oft kein juristischer, sondern ein emotionaler: Anerkennen, dass die Situation kritisch ist – und es erlaubt ist, sich helfen zu lassen.
Wann ist eine Insolvenz rechtlich notwendig?
Für Selbstständige wird die Insolvenz nicht nur zur Option, sondern zur Pflicht, wenn bestimmte gesetzlich definierte Bedingungen erfüllt sind. Die Insolvenzordnung (InsO) nennt drei zentrale Gründe für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens:
- Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO): Wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, Ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
- Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO): Wenn absehbar ist, dass Sie künftig Ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen können.
- Überschuldung (§ 19 InsO): Wenn das Vermögen Ihres Unternehmens die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und keine positive Fortführungsprognose besteht.
Für juristische Personen und bestimmte Personengesellschaften besteht gemäß § 15a InsO eine gesetzliche Pflicht, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Bei schuldhaftem Verstoß drohen zivil- und strafrechtliche Konsequenzen.
Auch für natürliche Personen, wie Einzelunternehmer, ist eine frühzeitige Antragstellung ratsam, um die Möglichkeit der Restschuldbefreiung (§ 286 InsO) nicht zu gefährden. Ein verspäteter Antrag kann dazu führen, dass Gläubiger die Versagung der Restschuldbefreiung beantragen (§ 290 InsO).
Es schadet also absolut nicht, sich rechtzeitig juristische Hilfe zu suchen, um Ihre Möglichkeiten erklärt zu bekommen und einen strukturierten Plan auszuarbeiten.
Rechtsanwalt Hermann Kaufmann steht für eine umfassende Beratung zum Thema „Insolvenz für Selbstständige“ und gibt Ihnen Hilfestellungen, wenn Sie von einer Insolvenz betroffen sind.
Wie läuft ein Insolvenzantrag ab – und was bedeutet das für mich?
Das Insolvenzverfahren für Selbstständige wird häufig als Regelinsolvenzverfahren durchgeführt (§ 305 InsO). Ehemals Selbstständige können unter bestimmten Voraussetzungen das Verbraucherinsolvenzverfahren (§ 304 InsO) nutzen, insbesondere wenn sie nicht mehr als 19 Gläubiger haben und keine Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen bestehen.
Ablauf des Regelinsolvenzverfahrens:
- Antragstellung: Der Insolvenzantrag ist beim zuständigen Insolvenzgericht einzureichen. Er muss vollständige Angaben zu Vermögen, Schulden und Gläubigern enthalten.
- Eröffnungsverfahren: Das Gericht prüft, ob ein Insolvenzgrund vorliegt und ob die Verfahrenskosten gedeckt sind. Gegebenenfalls wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt (§§ 21–22 InsO).
- Verfahrenseröffnung: Bei Vorliegen der Voraussetzungen eröffnet das Gericht das Insolvenzverfahren und bestellt einen Insolvenzverwalter (§ 27 InsO).
- Verwertung der Insolvenzmasse: Der Insolvenzverwalter verwertet das pfändbare Vermögen und verteilt die Erlöse an die Gläubiger (§§ 159 ff. InsO).
- Wohlverhaltensphase: Nach Abschluss der Verwertung beginnt die Wohlverhaltensphase, in der der Schuldner bestimmten Obliegenheiten nachkommen muss (§ 295 InsO). Für Selbstständige bedeutet dies, dass sie den Betrag abführen müssen, der dem pfändbaren Einkommen eines vergleichbaren Angestellten entspricht (§ 295 Nr. 2 InsO).
- Restschuldbefreiung: Nach erfolgreichem Abschluss der Wohlverhaltensphase kann das Gericht die Restschuldbefreiung erteilen (§ 300 InsO). Seit dem 17. Dezember 2020 beträgt die Dauer der Wohlverhaltensphase in der Regel drei Jahre, unabhängig von der Höhe der zurückgezahlten Schulden.
Es ist wichtig zu beachten, dass bestimmte Verbindlichkeiten, wie Geldstrafen oder Schulden aus vorsätzlichen unerlaubten Handlungen, von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind (§ 302 InsO).
Rechtsanwalt Hermann Kaufmann steht für eine umfassende Beratung zum Thema „Wann Insolvenzantrag stellen“ zur Verfügung: Nehmen Sie gerne Kontakt auf!
Was hilft in der Krise? Zwischen Strategie, Selbstschutz und realistischer Einschätzung
Wenn wirtschaftliche Probleme die gesamte Lebensrealität prägen, geraten klare Entscheidungen schnell aus dem Blick. Viele Betroffene berichten, dass sie „nicht mehr klar denken konnten“. Das ist kein Zeichen von Schwäche – sondern Ausdruck von chronischem Stress. Wer permanent im Alarmmodus lebt, kann nur schwer langfristige Pläne entwickeln.
Hier können Gespräche mit Dritten helfen – sei es mit Freunden, einer Schuldnerberatung oder einem Anwalt. Nicht, weil sie alles für Sie übernehmen, sondern weil sie dabei helfen können, wieder Orientierung zu gewinnen. Manchmal braucht es einfach ein Gegenüber, das die Dinge mit Abstand sieht.
Wichtig ist auch: Wer sich Unterstützung holt, bleibt handlungsfähig. Das Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen – selbst in einer schwierigen Lage – kann emotional entlasten und neue Handlungsspielräume eröffnen.
Fazit: Insolvenz ist kein Ende – sondern oft ein realer Neuanfang
Niemand gründet ein Unternehmen mit dem Ziel, irgendwann Insolvenz anzumelden. Aber das Leben verläuft nicht immer planbar. Wenn Sie merken, dass Sie allein nicht mehr weiterkommen – finanziell, emotional oder organisatorisch – dann ist es kein Zeichen von Scheitern, sich Hilfe zu holen.
Die Insolvenz ist ein juristischer Rahmen. Aber für viele Selbstständige bedeutet sie primär eines: eine letzte Chance, sich von der erdrückenden Last zu befreien und neue Perspektiven zu entwickeln. Mit der richtigen Unterstützung, mit Zeit, Mut und einem klaren Blick auf die eigene Situation kann aus der Krise ein Weg entstehen, der zurück ins Leben führt – vielleicht anders als geplant, aber nicht weniger wertvoll.
Hilfe von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann | Fachanwalt für Insolvenzrecht
Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Aber Sie können beginnen, sich zu informieren – Schritt für Schritt. Seriöse Informationen, ein offenes Gespräch und realistische Einschätzungen helfen oft mehr als Durchhalteparolen oder hektischer Aktionismus.
Wenn Sie sich in Ihrer Situation wiederfinden, sprechen Sie mit jemandem. Ob rechtlich, menschlich oder organisatorisch – es gibt Wege, aus der Überforderung herauszukommen. Und Sie müssen sie nicht allein gehen.
📞 Tel.: 04202 / 638370
📧 E-Mail: info@rechtsanwaltkaufmann.de
Bei manchen Angelegenheiten ist es besser, einen Rechtsanwalt als Spezialisten einzuschalten – setzen Sie auf erfahrene Anwälte als Experten beim Thema Insolvenzrecht an Ihrer Seite!
Benötigen Sie eine Beratung zum Thema „Insolvenz Selbstständig“ oder suchen Sie einen kompetenten Anwalt im Insolvenzrecht?
Dann lassen Sie sich gerne von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann im Insolvenzrecht beraten.
Die enthaltenen Informationen in diesem Artikel dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Person. Sie stellen keine rechtliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen.
Eine individuelle Beratung mit einem Rechtsanwalt wird empfohlen, um Ihre spezifische Situation zu bewerten und eine maßgeschneiderte Vorgehensweise zu entwickeln.
Fragen und Antworten zum Thema Insolvenzverfahren Erklärung:
-
Was bedeutet die Insolvenz für Selbstständige und wann ist sie sinnvoll?
Die Insolvenz für Selbstständige kann in schwierigen finanziellen Lagen eine Möglichkeit sein, das Unternehmen neu auszurichten und eine Restschuldbefreiung zu erreichen. Sie ist besonders dann sinnvoll, wenn Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung drohen und keine Aussicht auf eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung besteht. Durch die Insolvenz haben Selbstständige die Chance, sich von belastenden Schulden zu befreien und mit einer neuen Perspektive beruflich neu durchzustarten. Ein Anwalt, wie Rechtsanwalt Hermann Kaufmann, kann hierbei helfen, die Chancen einer Insolvenz zu erkennen und den Prozess bestmöglich zu nutzen.
-
Wann sollte ich als Selbstständiger einen Insolvenzantrag stellen?
Der Zeitpunkt für die Stellung des Insolvenzantrags ist für Selbstständige entscheidend, um rechtliche Konsequenzen wie die Insolvenzverschleppung zu vermeiden. Ein Insolvenzantrag sollte dann gestellt werden, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nicht mehr abzuwenden ist. Wer unsicher ist, ob der Zeitpunkt für den Antrag schon erreicht ist, sollte eine rechtliche Beratung in Anspruch nehmen. Ein Anwalt, wie Rechtsanwalt Hermann Kaufmann, kann helfen, die finanzielle Lage korrekt einzuschätzen und so den Antrag frühzeitig und rechtssicher zu stellen.
-
Wie läuft das Insolvenzverfahren ab und welche Schritte beinhaltet es?
Das Insolvenzverfahren gliedert sich in mehrere Schritte, die für Selbstständige eine Struktur für den Umgang mit Schulden bieten. Zunächst erfolgt die Antragstellung, gefolgt von der Ernennung eines Insolvenzverwalters, der die Vermögenswerte verwaltet und die Gläubiger bedient. Am Ende des Verfahrens steht die Möglichkeit der Restschuldbefreiung, die den Selbstständigen von verbleibenden Schulden befreit. Ein Anwalt kann den Ablauf des Insolvenzverfahrens erklären und den Selbstständigen dabei unterstützen, alle rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und Fristen einzuhalten, um das Verfahren erfolgreich abzuschließen.
Mehr zum Thema Insolvenzrecht:
Quellen für Insolvenz Selbstständig:
- https://office.lexware.de/lexikon/insolvenzantrag/
- https://www.privatinsolvenz.net/selbststaendig/
- https://www.insolvenzverfahren.de/firmeninsolvenz/einzelunternehmen-und-selbstaendige/
- https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__27.html
- https://faithbehavioralhealth.com/why-do-i-have-a-delayed-emotional-response/
- https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/coping
- https://instart.de/insolvenz/insolvenzantrag
- https://www.schuldnerberatung.de/privatinsolvenz-selbststaendig/
- https://rechtsanwaltkaufmann.de/insolvenzrecht/schufa-nach-privatinsolvenz